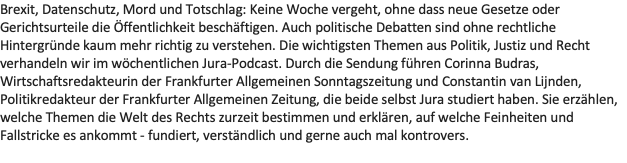
F.A.Z. Einspruch
Der Podcast, der die Woche neu verhandelt
Transkript
00:00:03: Herzlich Willkommen zu Folge.
00:00:05: threehundert vierhundsechzig des FAZ.
00:00:07: Einspruch Podcasts des Podcasts der FAZ.
00:00:10: Zurecht Justiz und Politik.
00:00:12: Mein Name ist Stefan Klenner.
00:00:13: Heute ist der fünfte November zweitausendfünfundzwanzig.
00:00:17: Und bei mir in Frankfurt ist wieder Finn Honenschwert.
00:00:19: Hi Finn.
00:00:20: Hi Stefan.
00:00:21: Wir starten heute mit einem Blick nach Karlsruhe, denn dort hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag eine wirklich interessante Entscheidung getroffen.
00:00:27: Die Richter haben nämlich den Verfassungsbeschwerden von mehreren Medizinern gegen die Triage-Regeln des Bundesinfektionsschutzgesetzes stattgegeben.
00:00:35: Wir ordnen die Hintergründer ein und sprechen über die Folgen dieses Beschlosses.
00:00:39: Dann dreht sich alles um ein juristisches Jubiläum, um ein fünfundsebzigstes um genau zu sein.
00:00:44: Für uns Juristen ist dieser Tage ja so ein bisschen die Zeit der fünfundsebzigsten Geburtstage.
00:00:48: In der letzten Woche feierten der Bundesgerichtshof und die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit einem großen Festakt ebenfalls ihren fünfundsebzigsten Geburtstag.
00:00:56: Und an diesem Dienstag gab es wieder einen Grund zum Feiern.
00:00:59: Die Europäische Menschenrechtskonvention ist nämlich auch seventy-fünf Jahre alt geworden.
00:01:03: Grund genug für uns, sich das Vertragswerk, das in der juristischen Ausbildung ja ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, zum Jubiläum mal ein bisschen genauer anzuschauen.
00:01:12: Und das mache ich gemeinsam mit der Juraprofessoren und früheren Richterin und Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Angelika Nussberger.
00:01:21: Ja, Stammgast in unserem Podcast, die war schon öfter zu Gast und ich bin gespannt, was ihr auch diesmal wieder erzählt.
00:01:27: Danach haben wir so eine kleine Nachlieferung und zwar ein Studiogespräch zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum kirchtlichen Arbeitsrecht.
00:01:36: Der ist ja schon knapp zwei Wochen alt, aber in der vergangenen Woche hatten wir ja Podcast mit Publikum, sodass wir das nicht zum Thema machen konnten.
00:01:44: Das wird nun nachgeliefert.
00:01:46: Danach gibt es auch wieder ein gerechtes Urteil.
00:01:48: Da verrate ich noch nicht worum.
00:01:50: geht.
00:01:51: Ich sage vielleicht nur so viel, es wird alkoholisch.
00:01:55: Ja und dann gibt es noch Hinweise und zwar zum einen nochmal den Hinweis auf unsere Ausschreibung.
00:02:02: Wir suchen ja einen neuen Redakteur, eine neue Redakteurin hier bei FAZ Einspruch in Frankfurt.
00:02:09: Also man sollte sich auch vorstellen können hier im wunderschönen FAZ Tower zu arbeiten.
00:02:14: Der eine oder andere wird sich schon gewundert haben.
00:02:17: Woran liegt das denn?
00:02:18: Warum wird das Einspruch-Team denn noch größer?
00:02:20: Da arbeiten doch schon so viele.
00:02:23: Hintergrund ist, dass ich zum ersten Januar als Korrespondent der FAZ nach Berlin gehe.
00:02:28: Das bedeutet nicht, dass ich hier völlig im Podcast verschwinde, aber ich werde nicht mehr ganz so viele Sendungen machen können wie bisher und wir brauchen deshalb jemand neuen im Team und freuen uns, wenn sie auch bereit sind, Podcast-Erfahrung einzubringen.
00:02:44: Sie finden die Ausschreibung unter frankfutterallgemeine.de in einem Wort und dann im Karrierebereich.
00:02:51: Jetzt richten wir den Blick nach Karlsruhe und wünschen gute Unterhaltung mit dem Gespräch zum Priagebeschluss des Bundesverfassungsgerichts.
00:03:01: Ja, du hast eben gesagt, gute Unterhaltung.
00:03:03: Da muss man sagen, das ist bei dem Thema natürlich nicht so ganz einfach.
00:03:07: Wir kommen eher zu harter Kost.
00:03:09: Es geht nämlich um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von gestern.
00:03:14: Da wurden die Triage-Regeln im Infektionsschutzgesetz für verfassungswidrig erklärt.
00:03:20: Vierzehn Intensiv- und Notfallmediziner, unterstützt von der Ärzte Gewerkschaft Marburger Bund, hatten Verfassungsbeschwerde eingelegt und Karlsruhe hat ihnen recht gegeben.
00:03:32: In der Tat, gerade in der Hochphase der Corona-Pandemie, war die Triage ja ein großes Thema, das in aller Munde war, eben zu einer Zeit, als die Intensivbetten und Beatmungsgeräte knapp wurden.
00:03:42: Triage, was heißt das?
00:03:43: Das ist eine Situation in der Ärzte im Notfall oder eben in einer Pandemie entscheiden müssen, wen sie zuerst behandeln.
00:03:51: Manchmal ist das leider auch gleich bedeutend mit der Entscheidung, wem sie das Leben retten und wem vor allem nicht.
00:03:56: Ja, also da merkt man schon, es ist ernst.
00:03:58: Und das Gesetz, um das es in Karlsruhe ging, das stammt auch aus einer ernsten Zeit.
00:04:03: Nämlich, dass es im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr.
00:04:25: Damals gab es die Aufforderung an den Gesetzgeber.
00:04:28: Regel das bitte.
00:04:30: So sieht es aus.
00:04:30: Die Karlsruher Richter haben diese Entscheidung aus dem Jahr, vor allem mit Blick auf Menschen mit Behinderungen begründet.
00:04:37: Sie sagen nämlich die Gefahr, dass Betroffene allein wegen ihrer Behinderung schlechtere Genesungschancen zugesprochen bekommen und dadurch eben bei einer Triage-Situation benachteiligt werden könnten.
00:04:47: Ja, und genau so.
00:04:48: eine Diskriminierung, die also ausschließlich an die Behinderung anknüpft, die sei nicht mit dem Grundgesetz zu vereinbaren.
00:04:54: Der Staat habe insofern eine Schutzpflicht.
00:04:56: Jetzt könnte man ja sagen, genau da hat doch der Gesetzgeber versucht anzusetzen.
00:05:01: Er hat dann ein Jahr später geliefert und diesen Paragrafen fünf C des Infektionsschutzgesetzes geschaffen.
00:05:08: Sollte man meinen, dass er geliefert hat, warum er das am Ende nicht getan hat.
00:05:12: Darüber und halten wir uns gleich.
00:05:13: Aber vielleicht gucken wir uns vorhin um, hat diesen Paragrafen fünf C an.
00:05:16: sieben Absätze.
00:05:18: Und die wichtigsten davon sind sicherlich die ersten beiden.
00:05:21: In Absatz eins ist nämlich ein Diskriminierungsverbot, also damit eine unmittelbare Antwort auf dieses verfassungsgerichtliche Urteil aus dem Jahr zwanzig, einundzwanzig.
00:05:31: Laut Absatz eins darf nämlich niemand bei einer Triage zum Beispiel wegen einer Behinderung, dem Alter, Herkunft oder dem Geschlecht benachteiligt werden.
00:05:41: Absatz zwei stellt dann klar, worauf es stattdessen ankommt.
00:05:44: Danach darf nämlich die Entscheidung einzig und allein aufgrund der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patienten getroffen werden.
00:05:53: Damit war Karl Zooe nun nicht zufrieden.
00:05:55: Es erklärte die Regelungen für verfassungswidrig.
00:05:58: Warum?
00:05:59: Die Richter sehen eben einen verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigten Eingriff und zwar in die Berufsfreiheit aus Artikel zwölf des Grundgesetzes.
00:06:08: In dem Beschluss stellen Sie fest, dass die Triage-Regelung in die Therapiefreiheit der Ärzte eingreift.
00:06:13: Was ist die Therapiefreiheit?
00:06:14: Das ist die Entscheidung über das Ob- und das Wie-einer-Halbehandlung.
00:06:18: Ja, diese Eingriffe in Grundrechte, das wissen wir aus der Grundrechtevorlesung, die können verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein.
00:06:26: Und damit wären sie zulässig, so wäre es auch hier.
00:06:30: Also, Vorgaben zur Triage darf der Gesetzgeber machen, wenn sie verfassungsrechtlich gerechtfertigt sind.
00:06:37: Dies ist hier aber nicht der Fall gewesen.
00:06:39: Denn, und auch das wissen wir aus der Grundrechtevorlesung, für einen verfassungsrechtlich gerechtfertigten Eingiff brauchen wir zuallererst ein formell rechtmäßiges Gesetz.
00:06:49: Und daran fehlt es hier überraschenderweise, denn Karlsruhe meint, der Bund sei für den Erlass der Triage-Regelung gar nicht zuständig gewesen.
00:06:56: Du sagst überraschenderweise, das ist ja an sich auch wieder überraschend, weil man sollte ja meinen, dass doch so ein Kompetenztitel bei so einem Gesetz ganz genau geprüft wird.
00:07:06: Ist der Fall, genau.
00:07:08: Viele Rechtsexperten hatten bei der Zuständigkeit im Vorfeld gar kein Problem gesehen, denn es gibt in Artikel seventy-vier Absatz eins Nummer neunzehn des Grundgesetzes eben eine ausdrücklichere Gesetzgebungskompetenz des Bundes für Maßnahmen gegen übertragbare Krankheiten.
00:07:23: Und darauf kann sich der Bund im Fall einer Triage, wie das Verfassungsgericht jetzt gesagt hat, aber nicht berufen.
00:07:30: Denn dieser Kompetenz bestehe laut Gericht nur dann, wenn das jeweilige Gesetz dazu dient, eine Krankheit einzudämmen oder ihr vorzubeugen.
00:07:38: Bei der Triage sei das aber nicht der Fall, denn die betrifft nur die Folgen einer Pandemie, aber eben nicht die Pandemiebekämpfung selbst.
00:07:46: Jetzt hast du ja eben schon die ganze Zeit auf deine frühere Grundrechtsvorlesung Bezug genommen.
00:07:52: Da können wir uns natürlich auch daran erinnern.
00:07:54: Bei der Grundrechtsprüfung war es ja so, dass eben dieses Kompetenzthema ganz am Anfang kommen.
00:08:00: Und ob dann wirklich eine Grundrechtsverletzung vorliegt.
00:08:03: Das kommt ja erst deutlich später, wenn es dann um die materiell rechtliche Prüfung geht.
00:08:08: Also in dem Fall, ob eben die Berufsfreiheit unverhältnismäßig eingeschränkt wurde oder nicht.
00:08:15: Da hat sich Karlsruhe jetzt aber bedeckt gehalten.
00:08:17: Leider muss man sagen, zumindest aus juristischer Perspektive, denn da wäre es natürlich spannend gewesen, wie das Gericht materiell rechtlich, also in der Sache nachgeurteilt hätte.
00:08:27: Können wir leider nicht sagen, denn, wie gesagt, das Verfassungsgericht ist bereits bei der Vormellenrechtmäßigkeit ausgeschieden.
00:08:34: Die Beschwerdeführer, also die Ärztinnen und Ärzte, hatten in dem Verfahren aber hier zu einige interessante Anmerkungen beziehungsweise Kritikpunkte vorgetragen.
00:08:43: Sie haben nämlich unter anderem vorgetragen, dass diese Kriterien in dem Gesetz, nach denen die Überlebenswahrscheinlichkeit nach Absatz zwei, den ich gerade kurz vorgetragen habe, berechnet werden soll, dass sie viel zu unklar sein.
00:08:54: Und die Ärzte hatten Sorge, dass sie aufgrund dessen falsche, unsaubere Entscheidungen treffen und hinterher berufrechtliche Konsequenzen zu befürchten haben.
00:09:03: Und Sie haben darauf aufmerksam gemacht, dass es innerhalb dieses Paragrafen fünf C des Bundesinfektionsschutzgesetzes auch Widersprüche gibt.
00:09:11: Denn auf der einen Seite verbietet das Gesetz in Absatz eins die Diskriminierung wegen einer Gebrechtlichkeit.
00:09:17: Allerdings muss man aussagen, dass eben bei der Bemessung der Überlebenswahrscheinlichkeit im Sinne von Absatz zwei genau diese Gebrechtlichkeit aber natürlich eine Rolle spielen kann.
00:09:25: Ein anderer Punkt, der die Beschwerdeführer umtreibt, ist die sogenannte Expostriage.
00:09:31: Da geht es darum, dass Ärzte eine bereits begonnene Behandlung nicht abbrechen dürfen, wenn ein neuer Patient bessere Überlebenschancen hat.
00:09:41: Zu all diesen Fragen hat aber Karlsruhe, wie gesagt, nichts gesagt.
00:09:45: Also jeder, der jetzt meint, naja, ich gucke mir den Beschluss an und bin dann für die nächste Klausur gut vorbereitet.
00:09:52: So einfach ist es nicht.
00:09:55: ist völlig offen, wie das die Verfassungsrichter sehen.
00:09:59: So sieht es leider aus.
00:10:00: Also man hört schon ein bisschen durch, so ganz zufrieden bin ich zumindest nicht mit der Entscheidung aus Karlsruhe.
00:10:05: Die Konsequenz ist jetzt, dass der Gesetzgeber eben noch mal dran muss.
00:10:10: Die Landesgesetzgeber sind also gefragt.
00:10:12: Und das Ganze hätte man ganz einfach vermeiden können, finde ich.
00:10:15: Also das Bundesverfassungsgericht hat ja im Jahr zwanzigundzwanzig schon mal die Gelegenheit, sich mit den Triage-Regelungen auseinanderzusetzen.
00:10:22: Und hat damals gesagt, dass der Gesetzgeber eben eine Regelung schaffen muss.
00:10:27: In einem einfachen Halb- oder Nebensatz hätte man auch klarstellen können, wer genau mit Gesetzgeber gemeint ist, also ob damit eben Bund oder Länder gemeint sind.
00:10:34: Das hat Karlsruhe unterlassen und infolgedessen gab es jetzt eben diesen Umweg über das Bundesverfassungsgericht und die Aufforderung an den Gesetzgeber nochmal ran zu müssen.
00:10:45: Das hätte man, ja, meine Ansicht nach.
00:10:48: wäre das formalbar gewesen.
00:10:50: Wobei es mit dem Halbsatz vielleicht auch nicht so einfach gewesen wäre, ne?
00:10:54: Weil du hast natürlich recht.
00:10:55: Auf der einen Seite sind jetzt im Prinzip die Länder am Zug.
00:10:59: Es gab aber auch einen Hinweis der Richter, dass der Bund auch nicht völlig aus dem Spiel ist.
00:11:05: Es gibt ja andere Kompetenztitel, wo der Bund eine Zuständigkeit hat, zum Beispiel das Zivilrecht.
00:11:11: Und es wäre ja auch denkbar, dass man Schutzvorkehrungen gegen Diskriminierung im bürgerlichen Recht im Arzt-Patienten-Verhältnis verankert.
00:11:21: Karlsruher hat sich so ausgedrückt, dass sei zumindest nicht von vornherein ausgeschlossen.
00:11:27: Also das mit dem Halbsatz wäre vielleicht dann doch nicht so leicht gewesen.
00:11:31: Kann man so sehen, allerdings muss man auch dazu sagen, dass eben durch diesen Hinweis auf das Zivilrecht Karlsruhe jetzt auch nicht wirklich für Kleid gesorgt, sondern eher für neue Irritationen gesorgt hat.
00:11:41: Denn wer ist denn jetzt schon zuständig?
00:11:43: Sind es die Landesgesetzgeber?
00:11:44: Ist es der Bundesgesetzgeber?
00:11:46: Man weiß es nicht.
00:11:47: Dadurch droht natürlich jetzt, wer auch immer jetzt das Triagegesetz in seinem Zuständigkeitsbereich verortet und eine neue Regelung entwirft, dass es eben eines Tages wieder auf dem Tisch der Richter in Karlsruhe landet und abermals aufgehoben wird.
00:12:00: wir dann eine Triage III Entscheidung haben.
00:12:03: Bleibt abzuwarten, wer jetzt das Zepter in die Hand nehmen wird, ob es der Bund oder die Länder sind, sollten die Länder es übernehmen.
00:12:09: Droht natürlich auch so ein bisschen die Gefahren des Flickenteppigs.
00:12:13: Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch sein, dass die Länder zu einer gemeinsamen Lösung kommen, sich also koordinieren und in allen Ländern eine einheitliche Lösung gefunden wird.
00:12:21: Wir müssen es ein bisschen abwarten.
00:12:23: Ja, als großer Fan des Föderalismus würde ich natürlich sagen, ein Flickenteppich ist nicht immer eine Gefahr, sondern es gibt auch viele Dinge, wo die Länder auch etwas besser regeln können.
00:12:34: zugegebenermaßen auch noch nicht ganz so sicher, ob das bei der Triage wirklich der Fall ist, weil es natürlich auch manchmal da Krankenhäuser gibt, die über die Ländergrenzen hinweg eine Funktion haben.
00:12:45: Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass egal wer jetzt handelt, ob der Bund oder die Länder, der Bund dann wie gesagt bei dem Punkt Zivilrecht, dass das wieder in Karlsruhe landen wird, gerade bei diesem Thema Schutz des Lebens, wo es ja am Ende in Triage Entscheidungen immer drum geht.
00:13:03: Das ist ja ein ganz sensibles Thema, wo zum einen Beschwerdeführer und auch Ärzte verständlicherweise sehr sensibel sind, zum anderen aber auch Karlsruhe immer wieder gezeigt hat, dass es solche Verfassungsbeschwerden sehr ernst nimmt.
00:13:18: Es wird also ein Thema für unseren Podcast bleiben und sobald es da etwas Neues gibt, liefern wir natürlich, was es dazu gibt.
00:13:29: Die Europäische Menschenrechtskonvention feiert ihren fünfundsebzigsten Geburtstag.
00:13:33: Am vierten November, da wurde das Vertragswerk von den Mitgliedstaaten des Europarats unterzeichnet.
00:13:39: An Geburtstagen blickt man gerne zurück, zieht Bilanz und wagt einen vorsichtigen Blick in die Zukunft.
00:13:45: Und genau das wollen wir heute tun.
00:13:47: Dazu freue ich mich sehr, unseren heutigen Gast, Frau Prof.
00:13:50: Angelika Nussberger, am Einspruch Podcast begrüßen zu dürfen.
00:13:54: Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Verfassungsrecht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln, war von und von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von von.
00:14:25: Ich denke, es ist wirklich ein Grund, zu feiern.
00:14:28: Denn ein derartiger Vertrag ist doch eine Besonderheit und ein Markenzeichen für Europa.
00:14:34: Dass es in den Seventinen Jahre gehalten hat und sich dieses System sehr gut entwickeln konnte, ist erst mal für mich ein Grund, zu feiern.
00:14:44: Dass man immer, wenn man feiert, auch nachdenkt, wie es weitergeht.
00:14:47: Und gerade, wenn das Kind schon etwas älter geworden ist, ist, glaube ich, eine natürliche Reaktion.
00:14:53: Aber erst einmal würde ich doch das und die Freude darüber, dass dieses System so lange gehalten hat, in den Vordergrund stellen wollen.
00:15:00: Jetzt haben Sie der Konvention hier an gewisser Weise sogar ein Geburtstagsgeschenk gemacht.
00:15:04: Und zwar haben Sie bei uns auf FAZ Einspruch ein Gastbeitrag zum fünftem siebzigsten Geburtstag geschrieben.
00:15:08: Sie leiten den Text mit folgendem, wie ich finde, sehr interessanten Satz ein.
00:15:13: Aus Hoffnungen können Verträge werden.
00:15:15: Nehmen Sie uns vielleicht mal mit in die Anfangsjahre der Europäischen Menschenrechtskonvention.
00:15:19: Welche Ereignisse und damit verbundenen Hoffnungen führten in der Konvention zu unterzeichnen?
00:15:25: Es war die Nachkriegszeit und es war der Versuch, Europa, das ja vollkommen zerstört war, wieder aufzubauen und zwar nicht nur physisch, sondern eben auch rechtlich, weil auch die Rechtssysteme ja zerstört waren, der Glaube in das Recht und die Gerechtigkeit vollkommen unterminiert waren.
00:15:43: Und in den ersten fünf Jahren nach dem Kriegsende relativ unmittelbar gab es verschiedene Initiativen zur Kodifizierung von Menschenrechten.
00:15:55: Auf der universellen Ebene war ja dann die Arbeit von Eleanor Roosevelt zur Ausarbeitung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte erfolgreich.
00:16:05: Bevor noch der endgültige Text festgestellt war, begann die Arbeit an der Europäischen Menschenrechtskonvention.
00:16:11: Es war nicht direkt parallel, aber etwas zeitversetzt, aber fast parallel.
00:16:16: Die Idee war eben für die Europäer neben das Unverbindliche als Deklaration gedachte Instrument auf der universellen Ebene ein eigenes Instrument zum Menschenrechtschutz zu schaffen.
00:16:28: Die Besonderheit in Europa war dann zum einen, dass es eben sehr verschiedene Vorstellungen davon gab, wie intensiv ein derartiges Menschenrechtschutzzystem die Souveränität der Staaten beeinträchtigen dürfte und zum anderen, dass sich schon eine Spaltung Europas abgezeichnet hat in Ost und West, die dann letztlich auch dazu geführt hat, dass man relativ schnell zu einem Ergebnis kam.
00:16:53: Jetzt trägt ihr Gasbeitrag den Titel in guten wie in schlechten Zeiten und spielt damit natürlich so ein bisschen auf die Ehe an.
00:17:00: und wie es bei Ehejubiläen üblich ist.
00:17:02: Teilen Sie die Geschichte der Konvention und des Gerichtshofs in dem Beitrag in farbige Epochen ein.
00:17:06: Da gab es zuerst die Grüne Periode, die Anfangsphase der Menschenrechtskonvention und des Gerichtshofs, in der die Menschenrechten noch ein Experimentierfeld waren.
00:17:15: Dann eine brancene Periode, in der die Konvention und der Gerichtshof mehr und mehr sichtbar wurden.
00:17:21: Im Anschluss gab es allerdings laut Ihrem Beitrag erst eine goldene und danach eine silberne Periode.
00:17:27: Damit brechen Sie ja so ein bisschen aus dieser zeitlichen Eologik aus.
00:17:30: Warum?
00:17:32: Weil ich damit versucht habe, die Entwicklung nachzuzeichnen, dann durch den Fall der Mauer und die Neuorientierung einer Vielzahl von Rechtssystemen in Mittel- und Osteuropa hat die Konvention einen unglaublichen Schub erfahren, denn plötzlich galt sie als das Orientierungsinstrument.
00:17:51: Man wollte dem Europarad beitreten, man wollte die Konvention unterzeichnen, man wollte diese Menschenrechte für sich zum Maßstab machen.
00:18:01: Staaten wie Polen, Tschechische Republik, Slowakische Republik, auch Russland, Ukraine in all diesen Staaten.
00:18:09: Und das war natürlich eine äußere Entwicklung, eine politische Entwicklung.
00:18:13: die von außen kam und das Instrument Europäische Menschenrechtskonvention plötzlich zu einem Kassenschlager gemacht hat, wenn ich so profan ausdrücken darf.
00:18:23: Also es war innerhalb der neunziger Jahre ein Rennen, um Beitritte und Ratifikationen zu beobachten.
00:18:32: Und deshalb habe ich gesagt, aus dieser pronsenen Zeit, in der die ... Konvention sich weiterentwickelt hat, die Reputation verbessert wurde, sie bekannter wurde, kam dann plötzlich diese goldene Phase, wo jeder sagte, das ist das Beste, was wir haben können und wir wollen es so schnell wie möglich haben.
00:18:50: Und dieser Logik folgend, in welcher Phase befinden wir uns jetzt gerade?
00:18:54: Und welche Farbe würden Sie ergeben?
00:18:56: Ja, das ist eben in meinem Beitrag auch offen geblieben.
00:18:59: Also nach der goldenen Phase kommt eben die silberne Phase, von der ich sagen würde, das war die Phase, die ich selbst am Gerichtshof erlebt habe.
00:19:07: Er war anerkannt, es ging alles gut, aber er hatte doch mit deutlichen Schwierigkeiten schon zu kämpfen.
00:19:13: Zum einen kamen zu viele Beschwerden, sodass es auch zu lange dauert hat, um sie abzuarbeiten.
00:19:18: Zum anderen wurde schon sichtbar das einzelne Staaten Widerstand leisten, dass sie sich nicht mehr der Rechtsprechung einfach ohne Nachfragen unterwerfen wollen.
00:19:28: Also es war so eine Periode, die war noch sehr erfolgreich, es wurde auch viel gefeiert.
00:19:34: Aber es war doch eine Periode, wo man schon am Horizont erkennen konnte, dass es nicht immer einfach bleiben würde.
00:19:40: Dann sehe ich eben einen großen Einbruch durch die zwei große Ereignisse, die Pandemie einmal und dann den russischen.
00:19:48: Angriffskrieg auf die Ukraine und den nachfolgenden Hinauswurf oder Austritt.
00:19:53: Das ist eine strittige Frage aus dem Europarat und aus der Konvention.
00:19:58: Und nach diesem Einbruch befinden wir uns in einer Neufindungsphase, für die mir die Farbe eher schwerfällt zu bestimmen, vielleicht so ein Helga.
00:20:10: Strengender müsste es eigentlich die Diamantphase sein, wenn man in dieser Ehelung bleibt.
00:20:16: Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dass es zum Ausschluss Russlands kamen, zwanzig, zwanzig, eben aufgrund des Einmarsch in der Ukraine.
00:20:24: Glauben Sie in der Rückschau, dass dieser Ausschluss die Autorität der Konvention und das Gerichtshof eher gestärkt oder geschwächt hat?
00:20:30: Also hättest du nicht vielleicht auch Vorteile gehabt, wenn Russland noch der Juristiktion das Gerichtshofsunterläge?
00:20:35: Nein, ich glaube, an dem Punkt war tatsächlich keine Alternative mehr gegeben.
00:20:39: Also die Möglichkeit, Russland noch im System zu halten, war dann definitiv nicht mehr.
00:20:45: Eine Option, es ist ja dann auch sehr schnell gegangen.
00:20:49: Natürlich wäre es wünschenswert gewesen, den Menschenrechtschutz aufrechtzuerhalten aus ganz fundamental einsichtigen Gründen, zum einen, weil ja in Russland eine beispiellose Verfolgung von Andersdenkenden begonnen hat und genau das eigentlich passiert ist, was die Menschenrechtskonvention zu verhindern sucht, dass eben ein staatliches System ohne jede Bremse von außen immer willkürlicher mit den Menschen umgeht.
00:21:17: Und zum zweiten eben auch, dass die Menschen in der Ukraine, die ja nun den Angriffen ausgesetzt waren, auch dann von dem Instrument nicht mehr geschützt wurden, also in der ersten Phase schon noch, die ersten sechs Monate, weil die Konvention so lang weiter galt.
00:21:33: Aber danach eben nicht mehr.
00:21:35: Von daher wäre es natürlich wünschenswert gewesen.
00:21:37: Aber ein System braucht eine gewisse Gleichheit der Partner.
00:21:44: Und wenn die Partner miteinander im Krieg sind und keinerlei Grundwerte mehr gemeinsam anerkennen, dann ... sprengt es den Vertrag.
00:21:53: Der passiert ja doch auf einem guten Willen, auf einer gemeinsamen Grundeinstellung.
00:21:59: Und das funktioniert dann einfach nicht mehr.
00:22:02: Das hätte bei keiner Entscheidung mehr funktioniert, was sehr traurig ist, zuzugeben.
00:22:08: Aber ich glaube, es ist einfach dann die Realität.
00:22:11: Das zweite Großeignis, das Sie von angesprochen haben, war die Corona-Pandemie.
00:22:16: Das war ja eine Zeit, in der der Gerichtshof ... Nicht wirklich sichtbar war, kaum zu hören war, viele Klagen z.B.
00:22:22: von Ungeimpften Beschäftigten wurden abgewiesen.
00:22:25: War das in ihren Augen auch eine verpasste Chance, Maßstäbe für Menschenrechte in Krisenzeiten zu setzen und eben die Konvention und den Gerichtshof für Menschenrechte sichtbarer zu machen?
00:22:36: Nein, ich glaube nicht, dass es eine verpasste Chance war.
00:22:39: Es war eine Zeit, die extrem schwierig war für den Gerichtshof, schon allein die Frage, wie er weiter arbeiten kann mit den Menschen, die aus allen verschiedenen Ländern kommen, bei all diesen Einreisebeschränkungen, wie er überhaupt arbeiten kann.
00:22:52: Und ich glaube, das hat er doch sehr gut gemanagt, dass er immer noch weiter arbeiten konnte, wie auch ja nationale Gerichte mit eben diesen Schwierigkeiten.
00:23:01: Und dann war es natürlich erstmal eine sehr experimentelle Phase für alle, also schon erstmal für die nationalen Rechte.
00:23:09: wie sie mit den Grundrechtseinschränkungen, die aufgrund der Pandemie für notwendig befunden wurden, umgehen sollen.
00:23:18: Und in der ersten Phase hat eine Reihe von Staaten dann die Notstandsklausel ratifiziert oder entsprechende Erklärungen abgegeben, weil man eben dachte, wir können jetzt die Menschenrechte eben nicht in vollem Umfang schützen.
00:23:32: Das war eine Minderheit von Staaten und sie haben dann diese Erklärungen auch wieder zurückgenommen.
00:23:36: Also es war so experimentell die Frage, wie geht man jetzt mit Menschenrechtsschutz in so einer Zeit um?
00:23:43: Letztlich konnte man aber die Entscheidungen genauso treffen wie sonst, dass man eben bei der Abwägung zwischen Gemeinwohl und Einzelrechten auf diese Grundformel necessary in a democratic society, also was ist notwendig an Beschränkung in einer demokratischen Gesellschaft, bezugnehmen konnte und letztlich nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip prüfen konnte.
00:24:07: Aber wenn Sie nun die Rolle des Gerichtshofs konkret in der Pandemie ansprechen, dann ist er ja immer erst die letzte Instanz.
00:24:13: Es ist ja zuvor, die Notwendigkeit sich an die nationalen Gerichte zu wenden.
00:24:18: Deshalb konnte der EMR praktisch auch keine Notinstanz sein, sondern es lag eben zunächst an den Gerichten aller Mitgliedsstaaten, diese Fälle zu entscheiden und zum Teil eben auch in verschiedenen Instanzen zu entscheiden.
00:24:32: Und erst danach war der Gerichtshof selbst berufen.
00:24:36: nach dem Subsidiaritätsprinzip, dann zu prüfen, ob die Gerichte bei diesen Entscheidungen die Grundrechte nicht ausreichend berücksichtigt hätten.
00:24:44: Und es gab nun einen bekannten Schweizer Fall, der ging an den Gerichtshof, bevor die Schweizer Gerichte das wirklich ausjudiziert hatten und in der Kammer hat.
00:24:54: hat man dann eine Verletzung gefunden und in der großen Karma hat man es für unzulässig erklärt, weil man gesagt hat, man muss eben erst die nationalen Gerichte entscheiden lassen.
00:25:03: Also es war natürlich eine Situation der großen Einschränkung der Menschenrechte, die jeder auch am eigenen Leib erfahren hat.
00:25:11: Aber es war in dem Sinne nicht eine primäre Aufgabe des Gerichtshofs hier entscheiden zu können, sondern das Oblag schon den nationalen Gerichten.
00:25:21: Obwohl sozusagen erst immer der nationale Rechtsweg beschritten werden muss, ist es ja so, dass das Gericht der Europäische Gerichte für Menschenrechte seit Jahren unter Überlastung und langen Wartezeiten leidet, wenn man so möchte.
00:25:34: Haben Sie eine Idee auch aus Ihrer Erfahrung selber beim Gerichtshof, wie der Gerichtshof effektiver arbeiten könnte?
00:25:40: Wie wäre es zum Beispiel mit einer Vorinstanz, die hat ja der EURGH auch?
00:25:44: Ja, da werden sehr viele Überlegungen angestellt.
00:25:47: Ich würde mal ... Jetzt positiv, und wir sprechen ja auch am Geburtstag, positiv sagen, dass der Gerichtshof an die Verwaltung des Gerichtshofs wirklich sehr kreativer Maßnahmen zu finden, um schneller entscheiden zu können, also Fälle zum Beispiel thematisch zu kopieren, Dreiergremien einzusetzen, die sehr viel auch abarbeiten können, um nicht alles in die Kammern und in die große Kammer bringen zu müssen.
00:26:12: Also da gab es sehr viel kreative Verbesserung und mit Blick auf die vergleichsweise geringen Finanzen, das vergleichsweise geringe Personal, ist der Output wirklich beachtenswert.
00:26:25: Aber das ist dann auch schon wieder das Problem, weil wenn es einen guten Output gibt, dann kommen eben immer mehr Leute.
00:26:33: Und das sind ja siebenhundert Millionen, die theoretisch kommen können.
00:26:37: Und dann kommt das System dann doch schnell wieder an seine Grenzen.
00:26:40: Ja, es ist über vieles nachgedacht worden.
00:26:42: Vorinstanz gab es ja im Prinzip die längste Zeit, das Gerichtshof bis jetzt hat, die damalige europäische Menschenrechtskommission, die eben vorgefiltert hat.
00:26:53: Das ist praktisch eine Doppelung der Richter.
00:26:56: Wenn man so will, dann sind es eben die Kommissionsmitglieder, die vorher die Fälle entscheiden.
00:27:01: Das könnte man sicherlich machen.
00:27:03: Es verkompliziert aber das System dann nochmal, weil man muss eine Instanz durchlaufen und dann nochmal die zweite.
00:27:09: Man hat es erst abgeschafft, um einen direkten Zugang zum Gericht.
00:27:14: zu ermöglichen, ob die Wiedereinführung nun alles besser macht, wage ich zu bezweifeln.
00:27:19: Ich glaube, insgesamt werden die Verfahren dadurch nicht kürzer werden.
00:27:23: Das Hauptproblem sind eben die vielen Missverständnisse, dass sehr viele ihre Klagen an den Gerichtshof bringen, die dann für unzulässig erklärt werden.
00:27:31: Und das sind ja immer weit über neunzig Prozent.
00:27:34: Und da hat man ja die Einzelrichter eingeführt, damit die schneller arbeiten können.
00:27:39: Aber ... Der Gerichtshof von seiner Konstruktion will für alle offen sein, und wenn alle kommen, wird es immer wieder Stau geben.
00:27:47: Jetzt wird dem Gerichtshof gelindlich vorgeworfen, mit seinen Entscheidungen inhaltlich zu stark in politische Fragen einzugreifen, seine Zuständigkeit auszureizen, vor allem bei Fragen der Migration, aber auch der Klimapolitik.
00:28:00: Wie sehen Sie diesen Vorwurf?
00:28:01: Ist da ein wahrer Kern dran?
00:28:02: Das ist ein Grundproblem der Rechtsauslegung, wenn es nicht nur um die Entscheidungen von konkreten Einzelfällen geht, sondern um ... damit verbunden die Klärung von Grundsatzfragen.
00:28:13: Das werden Sie nie vermeiden können, wenn Sie einen Rechtstext haben, dass er ausgelegt wird und wenn er ausgelegt wird, dass man ihn eben auch erweitern und auslegt.
00:28:23: Natürlich gibt es in der Konvention keine Regelungen zum Klimaschutz.
00:28:27: Es konnte es nicht geben, in den letzten Jahren.
00:28:30: Es gibt aber auch keine Regelungen zur Migration.
00:28:33: Es gibt keinen Recht auf Asyl.
00:28:34: Das gab es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, kein direktes Recht auf Asyl, aber zumindest ein Recht, um Asyl nachzusuchen.
00:28:43: Das gibt es in der Konvention auch nicht.
00:28:46: Und auch die strittige Thematik der Rechte der sexuellen Minderheiten ist in der Konvention nicht angesprochen.
00:28:52: Der Gerichtshof hat dann aber in den Siebzigerjahren ganz grundsätzlich entschieden, dass er die Konvention nicht als ein in Stein gehauenes Instrument auslegen will, sondern lebendig, also diese Diktion des Living Instruments, um sie eben der modernen Gesellschaft anzupassen und auf die modernen Probleme reagieren zu können.
00:29:16: Diese Grundsatzentscheidung hat der Gerichtshof getroffen und diese Grundsatzentscheidung hat dann eben bedeutet, in immer weiter neu entstehenden Fallkonstellationen zu entscheiden.
00:29:28: Damit werden natürlich dann viele Fragen angesprochen, bei denen in den Staaten auch die einzelnen Parteien, politischen Parteien auch sagen, da haben wir unsere Konzepte, das ist nicht die Aufgabe des Gerichtshofs hier zu entscheiden.
00:29:42: Diese Grundfriktion wird es immer geben und es ist eben immer ein Ausgleichen einerseits effektiven Schutz zu leisten, wenn Probleme neu entdeckt werden, die vielleicht vorher gar nicht existent waren.
00:29:56: Man denkt ja an die Digitalisierung und den Rechtsschutz im digitalen Raum.
00:30:03: Andererseits aber auch zu akzeptieren, dass der Gerichtshof nicht dafür da ist, Politik zu machen.
00:30:10: Das ist im Allgemeinen ... mit vielen abstrakten Worten zu beschreiben, aber nie zu lösen.
00:30:17: Lösen kann man es immer nur am konkreten Einzelfall und am konkreten Einzelfall.
00:30:20: Wird man sich dann auch streiten, je nach Grundeinstellung, die man eben zu dem Fall hat.
00:30:26: Jetzt ist heute zweiter Geburtstag der Europäischen Menschenrechtskonvention.
00:30:29: gestatten Sie mir aber trotzdem noch eine kritische Frage, die man auch immer wieder hört, weil man sich mit Freunden und Kollegen über die Menschenrechtskonvention unterhält.
00:30:36: Ganz zynisch gefragt.
00:30:38: brauchen wir in Deutschland die Menschenrechtskonvention und den Gerichtshof in Straßburg überhaupt, da wir ja die Grundrechte, das Bundesverfassungsgericht, die EU-Verträge mit dem europäischen Gerichtshof haben, was also leistet die Menschenrechtskonvention, was nicht durch die anderen Institutionen schon längst abgedeckt ist.
00:30:57: Ich gebe Ihnen so für ein Recht, dass wir in Deutschland ein gutes Rechtsschutzsystem haben, mit schon zwei Schichten, wie Sie sagen, also dem Grundrechtsschutz durch das Bundesverfassungsgericht und dann eben auch auf europäischer Ebene, sogar wir haben drei Schichten, wenn man will, auch noch auf Landesverfassungsebene.
00:31:15: Warum noch eine Schicht mehr?
00:31:18: Die Lehre kam eben nach dem Zweiten Weltkrieg, bei dem man gesehen hat, die Staaten können es nicht.
00:31:24: Und das Problem ist eben, sie können es immer leicht auch wieder abbauen.
00:31:27: Also auch ein Schutz, der hoch einen hohen Standard erreicht hat, kann abgebaut werden.
00:31:33: Und da ist eben die Grundidee des internationalen Menschenrechtschutzes, dass man dann auch von außen auf Entwicklungen schauen kann.
00:31:41: Wenn Sie jetzt in die USA blicken, da gibt es keine entsprechende Konventionen, die die Vereinigten Staaten gebunden werden, da würde man vielleicht manchmal jetzt wünschen, dass jemand von außen drauf schaut und schon mal die Alarmglocke schrillt.
00:31:56: Obwohl man auch hätte sagen können, das ist doch ein wunderbar konsistenter Menschenrechtschutz, den man über die Jahre dort garantiert hat.
00:32:04: Also es geht genau um diese Frage, diese Problematik eines möglichen Rückschritts, denn etwas, was man erreicht hat, muss nicht immer so bleiben.
00:32:14: Und im Übrigen würde ich auch sagen, dass auch das Bundesverfassungsgericht doch in seinem Dialog mit dem EGMR immer wieder selbst bestätigt hat, dass es gut ist, dass es nochmal diesen anderen europäischen Maßstab gibt.
00:32:27: Und auch das Bundesverfassungsgericht, wenn Sie seine Rechtsprechung anschauen, sehen Sie einen sehr deutlichen Einfluss des Europäischen Gerichtshofs, oftmals nicht dadurch, dass der Gerichtshof Verletzungen von Deutschland feststellt, sondern dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht eben präventiv die europäischen Standards mit einbezieht.
00:32:46: entsprechend entscheidet.
00:32:47: Und von daher ist dieses System in der letzten Zeit doch gut gefahren, würde ich sagen.
00:32:52: Jetzt waren sie ja selbst auch viele Jahre Richterin und sogar Vizepräsidentin des Gerichtshofs.
00:32:57: Wie gut funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit mit den anderen Gerichten, über die wir gerade gesprochen haben.
00:33:01: Also vor allem mit Luxemburg und Karlsruhe.
00:33:04: Gibt es irgendeinen Austausch unter den Richtern, irgendeine Zusammenarbeit oder arbeitet jeder so ein bisschen für sich und schaut gar nicht so richtig nach rechts oder links, was die anderen eigentlich machen?
00:33:13: Man schaut sehr intensiv nach rechts und links.
00:33:16: Es gab institutionalisierten und informellen Austausch in großem Umfang.
00:33:21: Es gab zum einen regelmäßige Treffen.
00:33:24: Es gab ein Sexertreffen zwischen den deutschsprachigen Gerichten plus EGMR und EUGH.
00:33:29: Das gab's alle zwei Jahre.
00:33:33: Sexertreffen, das war noch Österreich, Lichtenstein, Schweiz, Luxemburg und die beiden Hüchstgerichte.
00:33:40: Es gab einen ... dauernd ein Dialog zwischen EUGH und EGMR.
00:33:44: Man hat sich immer wieder getroffen, entweder in Luxemburg oder in Strasburg.
00:33:49: Es gab einen häufigen Austausch mit dem Bundesverfassungsricht.
00:33:52: Dann hat man sich eben zu bestimmten Themen getroffen.
00:33:56: Man hat die Rechtsprechung des jeweils anderen Gerichts intensiv mitstudiert und hat dann eben sich über bestimmte thematische Fragen ausgetauscht.
00:34:07: Und dieser Dialog der Gerichte wurde von allen Seiten als extrem wichtig empfunden, da die Kompetenzen einfach gewachsen sind und nicht auf dem Reisbrett klar abgegrenzt sind.
00:34:18: Und daher gibt es immer wieder Konflikte und Überschneidungen und offene Fragen.
00:34:25: Deshalb fanden wir alle diesen direkten Austausch und dieses direkte Ansprechen von offenen Fragen so wichtig.
00:34:32: Gibt es eigentlich ein Lieblingsverfahren aus Ihrer Zeit am Europäischen Gerät zu für Menschenrechte?
00:34:37: Ein Verfahren, das Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
00:34:39: Ja, es gab verschiedene Verfahren, die mir sehr im Gedächtnis geblieben sind.
00:34:45: Zum einen natürlich die großen Fälle, also Lambert über Sterbehilfe und SAS über die Burka.
00:34:52: Das waren so sehr sichtbare Fälle, in denen ich damals auch in der großen Kammer war und diesen Diskussionsprozess unmittelbar miterlebt habe.
00:35:03: Es gab aber auch eine Reihe von Kammerfällen, die mich sehr beschäftigt haben.
00:35:09: Fälle, die nicht so spektakulär waren, aber im persönlichen eben extrem wichtig.
00:35:14: Wenn Eltern ein Kind weggenommen worden ist, wegen eines Missverständnisses und dieses Missverständnis aufgeklärt werden konnte beispielsweise, dann waren das schon auch Fälle, die mich sehr bewegt haben.
00:35:25: Jetzt sind es ja nicht nur ... ehemalige Richterin und Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, sondern auch Juraprofessoren.
00:35:34: Und wenn ich mich so an meinen Jurastudium zurück erinnere, dann stelle ich fest, dass die Menschenrechtskonvention und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eher eine stiefmütterliche Behandlung erfahren haben, nur ganz selten vorkamen.
00:35:46: Meinen Sie, die Menschenrechtskonvention sollte in der Ausbildung eine größere Rolle spielen?
00:35:51: Also jetzt gleich, wenn dieses Gespräch zu Ende ist, werde ich Vorlesungen halten, Grundrechte, Vertiefungen.
00:35:58: Und da spreche ich dann auch die Rechtsprechung des EGMR an.
00:36:03: Heute zum Beispiel den Fall, in dem Deutschland verurteilt wurde, weil es ein Gesichtsschutz in einer Demonstration ganz abstrakt für Strafbarhielt.
00:36:15: Also, man leert, indem man den deutschen Grundrechtschutz erläutert und gibt dann den Ausblick auf den europäischen Grundrechtschutz und was der bedeutet.
00:36:25: Im Übrigen halte ich auch eine Vorlesung über International Human Rights, die großen Zuspruch findet, weil ich glaube, die Studierenden sich... doch auch sehr dafür interessieren, was es international gibt.
00:36:36: Insgesamt fällt auf, dass Deutschland da etwas selbstbezogen ist und weniger auf diese internationalen Instrumente eingeht, als ich es in anderen Ländern, bei unseren Nachbarn in den Niederlanden, in Belgien, auch in Frankreich erlebe.
00:36:51: Ich denke, dass es gut ist, wenn es bei uns eben auch mitgedacht wird, wir leben in diesem Mehrebenensystem des Rechts und das muss auch den Studierenden vermittelt werden.
00:37:02: Jetzt sind Geburtstage immer ein Anlass für gute Wünsche.
00:37:05: Wenn Sie der Europäischen Menschenrechtskonvention auf den Weg geben könnten, was würden Sie für die kommenden vielleicht sogar für die nächsten seventy-fünf Jahre wünschen?
00:37:15: Ich würde wünschen, dass sie bedeutungsvoll für die Gesellschaften in den europäischen Staaten bleibt.
00:37:20: Dass sie weiterhin ein wirksames Instrument sein kann.
00:37:24: Und wenn sie tatsächlich noch seventy-fünf Jahre besteht, so wie sie jetzt besteht, dann wäre das für Europa ein großartiger Erfolg.
00:37:32: Das ist doch ein prima Schlusswort.
00:37:33: Vielen Dank, Frau Nussberger, für dieses Gespräch zum fünben siebzigsten Geburtstag der Europäischen Menschenrechtskonvention.
00:37:39: Sehr gerne, vielen Dank.
00:37:46: Vor knapp zwei Wochen hat der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts eine Grundsatzentscheidung zum kirchlichen Arbeitsrecht veröffentlicht.
00:37:52: Da wir in der vergangenen Woche den Podcast mit Publikum aus Leipzig gesendet haben, konnten wir den Beschluss noch nicht hier besprechen.
00:37:58: Das wollen wir an dieser Stelle nachholen.
00:38:00: Der Fall um den es in Karlsruhe ging, hat eine lange Geschichte.
00:38:03: Wir müssen in das Jahr zwölf zurückgehen.
00:38:06: Ja, im Jahr zwölf habe ich noch studiert.
00:38:08: Ich musste dann auch erst mal nachgucken, was ist da eigentlich alles passiert.
00:38:12: Es ging damals darum, dass sich eine Sozialpädagogin beim evangelischen Berg für Diakonie und Entwicklung beworben hatte, und zwar auf eine Stelle als Referent hin zu Menschenrechtsthemen.
00:38:24: Sie sollte sich da vor allem mit der UN-Antiracismus-Konvention befassen.
00:38:29: Und in der Stellenausschreibung, da hatte die Diakonie eine Kirchenmitgliedschaft verlangt.
00:38:35: Die Bewerberin ist dann darauf gar nicht eingegangen, also die war schon aus der Kirche ausgetreten, hat aber einfach in der Bewerbung dazu nichts geschrieben.
00:38:43: Wurde dann nicht eingeladen zum Vorstellungsgespräch und hat danach in mehreren arbeitsgerichtlichen Instanzen eine Entschädigung verlangt.
00:38:51: Das Bundesarbeitsgericht hat dann auch, dass die Diakonie zu einer Zahlung von verurteilt, weil die Bewerberin wegen ihrer fehlenden Kirchenmitgliedschaft diskriminiert worden sei.
00:39:05: Und die Erfurter Richter haben das auch mit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg begründet.
00:39:13: Deren hatten sie nämlich vorher befragt zum Verhältnis von kirchlichem Selbstbestimmungsrecht und Diskriminierungsschutz.
00:39:20: Und die Luxemburger Richter wiederum, die hatten geurteilt, dass wenn die Kirche eine Bewerbung mit der Begründung ablehnt, die Religion sei eine berufliche Anforderung, dann müsse das auch gerichtlich kontrolliert werden können.
00:39:35: Und an dieser Entscheidung aus Luxemburg ist auch das Bundesverfassungsgericht natürlich gebunden.
00:39:39: Auf den ersten Blick ist deshalb ein bisschen erstaunlich, dass die Verfassungsbeschwerde der Diakonie ja gegen diese Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts Erfolg hatte.
00:39:47: Allerdings, Karlsruhe geht nicht auf Konfrontationskurs zum OGH, ganz im Gegenteil.
00:39:53: Die Richter betreiben in ihrem Beschluss sogar ziemlich viel Aufwand, um an ihrem Respekt vor dem OGH keinen Zweifel zu lassen.
00:40:00: Der Vorrang des Europarechts sei zwingend, heißt es, dass Luxemburger Urteil auch keine Überschreitung europäischer Befugnisse zum nationalen Recht bestünden, aber keine unüberwindbaren Widersprüche.
00:40:11: Mit anderen Worten, das Bundesarbeitsgericht hat aus Karlsruher sich die OGH-Entscheidung falsch verstanden.
00:40:17: Ja, da habe ich mir so ein bisschen gedacht, als ich das gelesen habe, dass das Bundesverfassungsgerichter quasi den OGH einerseits ganz stark umarmt und andererseits dann indirekt doch so ein bisschen sagt, ich mache was ich will, wobei man sagen muss, sie haben natürlich schon auch einen Ansatzpunkt.
00:40:34: Denn der OGH hat durchaus gestattet, dass die Kirchen für bestimmte Funktionen weiterhin eine Kirchenmitgliedschaft verlangen.
00:40:45: gerade dann, wenn nach außen eine Vertretung bei dieser Stelle gewünscht ist.
00:40:52: Und das war eben auch hier der Fall.
00:40:55: Es ging darum, dass dieser Menschenrechtsreferent für die Außenvertretung gegenüber Politik, Öffentlichkeit und Menschenrechtsorganisation zuständig sein sollte und gerade aus gristlicher Sicht Defizite bei der Umsetzung der UN-Antirassismus-Konvention aufzeigen sollte.
00:41:15: Und das Bundesverfassungsgericht sagt dann eben, naja, wenn das so ist, dann war offenbar doch die Religion hier ein wichtiger Faktor und das religiöse Selbstbestimmungsrecht der Diakonie überwiegt in dem Fall gegenüber den Interessen der Sozialpädagogin.
00:41:32: Ja, wir haben die Kirchen auf diesen Beschluss aus Karlsruhe reagiert.
00:41:35: Die haben den natürlich nachvollziehbarerweise begrüßt.
00:41:39: Allerdings muss man auch sagen, dass das Bundesverfassungsgericht so ein bisschen den Prüfungsmaßstab im Vergleich zu seiner früheren Rechtsprechung schon verschärft hat.
00:41:47: Es räumt in der Entscheidung ein, der OGH habe die bisherigen Maßstäbe des Verfassungsgerichts konkretisiert und mit diesen bisherigen Maßstäben meinen die Verfassungsrichter ihre eigene Rechtsprechung aus dem Jahr.
00:41:59: Damals hatte ein Chefarzt in Karlsruhe geklagt, der als geschiedener an einem katholischen Krankenhaus arbeitete, widerheiratete und dem daraufhin gekündigt wurde.
00:42:10: Vor dem Verfassungsgericht verlor er damals.
00:42:12: Die Richter gestanden den Kirchen damals einen gewaltigen Spielraum zu.
00:42:16: Vom Staat verlangten sie maximale Zurückhaltung.
00:42:19: Gerichte dürften die Anforderungsprofile kirchlicher Arbeitsstellen allein auf Plausibilität prüfen, so Karlsruhe.
00:42:25: Ja, da ziehst du jetzt quasi noch eine weitere Materie rein.
00:42:29: Aber diese weitere Materie, die ist wichtig, denn diese Chefarztgeschichte, die hatte damals in Luxemburg keinen Bestand.
00:42:36: Der EUGH gab dem Arzt recht und das fiel nur wenige Monate nach dem Urteil zu dieser Diakonie-Stelle.
00:42:44: Also da merkt man auch, es kommt wirklich auf die einzelnen Stellen immer an aus Perspektive des EUGH.
00:42:51: Und damals wurde eben gesagt, na ja, diese Plausibilitätskontrolle.
00:42:55: Das reicht nicht aus, sondern die Religionszugehörigkeit für eine Stelle, die muss objektiv geboten sein und auch verhältnismäßig.
00:43:05: Und ja, das diente eben dazu aus Luxemburger Perspektive, die Rechte der Kirchen und der Arbeitnehmer in Ausgleich zu bringen.
00:43:13: Ja, das Verfassungsgericht orientiert sich in seinem aktuellen Beschluss.
00:43:17: Nun, anders als früher an diesen Maßstäben, hält aber auch fest, dass dem kirchlichen Selbstverständnis weiterhin besonderes Gewicht bei gemessen werden dürfen.
00:43:26: Das OGH-Urteil lasse dem nationalen Recht schließlich Spielräume.
00:43:30: Karlsruhe spricht hier insofern von einer Grundrechtsbluralität und schweißt auf die unterschiedlichen religionsrechtlichen Verhältnisse in den Mitgliedstaaten hin, auch im Arbeitsrecht könne es deshalb zur Abweichung kommen.
00:43:41: In Deutschland ist das religiöse Selbstbestimmungsrecht im Grundgesetz besonders geschützt.
00:43:46: Dem Bundesarbeitsgericht wird Karlsruhe insofern vor, das nicht ausreichend berücksichtigt zu haben und die Luxemburger Vorgaben überspannt zu haben.
00:43:54: Anstatt die Perspektive der Diakonie zu beherzigen, hätten die Arbeitsrichter ihr eigenes Verständnis zum Maßstab gemacht.
00:44:01: Ja, also da hast du jetzt quasi den Schlenker wieder zugemacht aus diesen ganzen Urteilen des OGH hin zu der aktuellen Entscheidung in Karlsruhe.
00:44:12: Wie kann man das als Erkenntnis zusammenfassen?
00:44:14: Ich würde sagen, es bleibt bei einer großen Beinfreiheit der Kirchen.
00:44:19: Allerdings müssen die künftig genauer begründen, warum sie für eine Stellenausschreibung eine Kirchenmitgliedschaft verlangen und sich dann eben auch eine richterlichen Kontrolle stellen.
00:44:31: Das Karl Zuhe, dem kirchtlichen Selbstbestimmungsrecht, so einen hohen Stellenwert zugesteht.
00:44:36: muss man immer auch vor der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes verstehen.
00:44:41: Das Grundgesetz ist anders.
00:44:43: Du hast ja eben auch schon dieses Thema Grundrechtsbluralität angesprochen.
00:44:47: Anders als eben zum Beispiel die französische Staatsordnung.
00:44:51: Keine laizistische Verfassung.
00:44:53: Also es ist so, dass der Parlamentarische Rat vor Augen hatte, dass in der Vergangenheit, also in der NS-Zeit, es ja schon staatliche Versuche gab, die religiösen Inhalte.
00:45:06: von Religionsgemeinschaften auch mit Staatsideologie zu bestimmen.
00:45:11: Ein ganz bekanntes Beispiel sind dafür die sogenannten deutschen Christen in der evangelischen Kirche.
00:45:18: Und sowas sollte eben nicht wieder passieren.
00:45:20: Und deshalb ist im Grundgesetz da quasi so ein kleiner Schutzkatalog aufgestellt, gibt ja sogar Normen aus der Weimarer Reichsverfassung, die dann über den Artikel Hundertvierzig Grundgesetz in den Geltungsbereich unserer heutigen Verfassung integriert wurden.
00:45:36: Und dieser Schutzkatalog, der gewährleistet eben, dass die Kirchen ihr Selbstbestimmungsrecht verteidigen können.
00:45:45: Und das macht sich dann eben auch bei solchen Stellen Ausschreibungen bemerkbar.
00:45:50: Jetzt gibt es in Europa allerdings auch andere Rechtstraditionen, zum Beispiel Frankreich, über das du vorhin schon gesprochen hast.
00:45:55: Ich bin mir nicht sicher, ob der Europäische Gerichtshof mit der Karlsruher Interpretation seiner Vorgaben deshalb zufrieden sein wird.
00:46:01: Ich könnte mir auch vorstellen.
00:46:03: dass auch künftig kirchliche Arbeitsverhältnisse die Richter in Luxemburg deshalb beschäftigen werden.
00:46:08: Die Kirchen und ihre Verbände vergeben ja ziemlich unterschiedliche Stellen.
00:46:11: Da wird sich die Kirchenmitgliedschaft nicht überall als Einstellungsvoraussetzung rechtfertigen lassen.
00:46:16: Ja, das ist möglich.
00:46:18: Da gebe ich dir Recht.
00:46:19: Und es ist natürlich auch so, dass die Kirchen auch selber ihre Einstellungsvoraussetzungen schon verändert haben.
00:46:26: Ehrlich gesagt auch teilweise aus faktischer Not.
00:46:30: Also wenn du eine katholische Erzieherin in Mecklenburg-Vorpommern suchst, da bist du ganz schön lange am Suchen.
00:46:37: Man muss bestimmte... Stellen, wenn die besetzt werden, da auch sozusagen in den Anforderungen ein bisschen großzügiger werden.
00:46:45: Da haben sowohl die evangelische Kirche als auch die Deutsche Bischofskonferenz ihre Regularien auch schon angepasst.
00:46:52: Trotzdem ist es sicherlich so, dass solche Fälle auch immer noch mal in Karlsruhe oder Luxemburg landen werden.
00:46:59: Und wir werden natürlich dann genau hinschauen, ob sozusagen der OGH mit dieser Umarmung aus Karlsruhe zufrieden ist oder dann doch wieder sagt, nee, ihr habt uns da falsch verstanden.
00:47:14: Unser gerechtes Urteil kommt heute vom Landgericht Kiel.
00:47:17: Dessen Kammer für Handelssachen hat sich in der vergangenen Woche mit einem alkoholischen Getränk beschäftigt.
00:47:22: und zwar mit einem veganen alkoholischen Getränk.
00:47:24: Ja, zum Glück finde hast du jetzt nicht veganer Eierlikör gesagt, sonst könntest du nämlich Ärger bekommen mit dem Schutzverband der spirituosen Industrie.
00:47:33: Dem gefallen solche Bezeichnungen nämlich gar nicht.
00:47:36: Der Verband hat große Sorge, dass ein Getränk eines kleinen Unternehmens aus Schleswig-Holstein in seiner Aufmachung echten Eierlikör zu ähnlich ist, obwohl es sich gar nicht um Eierlikör handelt und obwohl da auch gar keine Eier drin sind.
00:47:51: Der Verband sei in einer ganzen Reihe von Bezeichnungen, die das Unternehmen verwendete, um eben dieses Getränk zu bewerben, ein Verstoß gegen EU-Recht.
00:47:59: Dabei ging es um Bezeichnungen wie Lequeur ohne Ei, Alternative zu Eierlequeur, aber auch Eierlequeur.
00:48:05: Naja, dass man ein Likör ohne Eier nicht als Eierlikör bezeichnen sollte, das dürfte ja eigentlich klar sein.
00:48:11: Ja, das hat das Unternehmen auch schnell eingesehen und gegenüber dem Schutzverband der spirituosen Industrie eine entsprechende Unterlassungserklärung abgegeben.
00:48:19: In Kiel ging es dann aber vor allem darum, ob Likör ohne Ei.
00:48:24: oder Alternative zur Eierlikör und schließlich veganerlikör ohne Eier, der wie Eierlikör schmeckt, zulässig sind.
00:48:31: Warum sollte das nicht zulässig sein finden?
00:48:34: Der Verband argumentierte die EU-Verordnung zum Bezeichnungsschutz von Spirituosen, der enthalte ein absolutes Verwendungs- und Anspielungsverbot.
00:48:42: Auf die Gefahr einer Irreführung kommen es da nicht an.
00:48:44: Und der Verband stützte sich darauf, dass der Bezeichnungsschutz auch bewirken kann, dass Bezeichnung in Verbindung mit anderen Wörtern wie Art, Typ oder der Zusatzgeschmack, ja, dass das unzulässig sei.
00:48:56: Damit konnten sie die Killerrichter aber nicht überzeugen.
00:48:59: Es ist ja auch was anderes, ne?
00:49:01: Also, ich sag mal, die Köhe ohne Ei.
00:49:03: Ist ja jetzt nicht so was wie Art oder Typ, weil damit will man ja den Eindruck erwecken, dass Produkt sei sehr ähnlich.
00:49:12: bei Likör ohne Ei oder Alternative zu Eierlikör, wird aber ja gerade das Andersartige betont.
00:49:19: Richtig.
00:49:20: So hat die Kammer für Handelssachen dann auch argumentiert.
00:49:22: Die Richter schreiben in ihrem Urteil bei der Feststellung, ob eben eine verbotene Anspielung auf eine rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung vorliegt.
00:49:31: sei darauf abzustellen, ob der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige europäische Durchschnittsverbraucher durch die streitige Bezeichnung veranlasst werde, einen unmittelbaren, gedanklichen Bezug zur Ware, die die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung trägt, herzustellen.
00:49:48: Ein ziemlich kompliziert anmutender juristischer Bandwurmsatz.
00:49:51: Aber ich denke, er trifft den Kern eigentlich ganz gut.
00:49:55: Nämlich, dass nicht jede Assoziation eine solche rechtlich relevante Anspielung ist.
00:50:00: finde ich auch plausibel, vor allem war ja auch dieser ganze Schutzzweck der entsprechende EU-Verordnung.
00:50:06: nicht ist, dass quasi Traditionsprodukte vor Konkurrenz vor anderen Produkten geschützt werden, sondern der Sinn dieser EU-Verordnung ist ja, dass das ansehen traditioneller Produkte geschützt wird und der Verbraucher, wenn er ein traditionelles Produktglaub zu kaufen, das dann auch bekommt, aber nicht, dass es da nicht auch andere Produkte geben darf.
00:50:31: Ja, die Richter unterscheiden in ihrem Urteil dann fein säuberlich zwischen Begriffen, die Wesensgleichheit mit einem Produkt herstellen und gegensätzlichen Begriffen wie Alternative zu.
00:50:42: Auch bei der Bezeichnung veganer Eierlikör ohne Ei, der wie Eierlikör schmeckt, steht nach Ansicht der Richter die Betonung des Gegensatzes im Vordergrund.
00:50:51: Das Unternehmen aus Schleswig-Holstein darf die genannten Bezeichnungen also weiter verwenden.
00:50:56: Trotzdem war es kein Komplettsieg vor Gericht.
00:50:59: Es muss fünftausend Euro zahlen, weil es trotz der Unterlassungserklärung bezogen auf den Begriff Eierlikör, dieser Begriff noch eine Zeit lang auf der Homepage des Unternehmens zu finden war.
00:51:11: Ja, Stefan, warum hast du die Entscheidung der Killerrichter als gerechtes Urteil ausgewählt?
00:51:15: Die examenrelevant dürfte dieses Mal ja ziemlich überschaubar sein.
00:51:18: Ja, da hast du recht.
00:51:19: Das ist diesmal nicht so.
00:51:20: das Königsargument, was sich fürs gerechte Urteil verwenden kann.
00:51:24: Ich habe das ehrlich gesagt einfach spannend gefunden, weil die Aufmerksamkeit zu groß war.
00:51:29: Ich glaube übrigens teilweise auch wegen eines Missverständnisses.
00:51:34: Es ist ja so, dass gerade auf EU-Ebene sehr stark über Regulierungen namens Bezeichnungen für vegetarische und vegane Fleischersatzprodukte gesprochen wird.
00:51:46: Und da gibt es eine nicht unerhebliche Strömung im Europaparlament, die das stärker reglementieren möchte.
00:51:54: Könnte mir vorstellen, dass deshalb auch diese Likör-Ohne-Ei-Entscheidung so viel Aufmerksamkeit gefunden hat, obwohl es juristisch eigentlich was anderes ist.
00:52:03: Denn es geht hier ja um die Auslegung bereits bestehender Regeln, in dem Fall eben um diese Schutzvorschriften für traditionelle Produkte bzw.
00:52:14: auch für Spirituosen ganz konkret und nicht um diese neuen Reformvorstöße.
00:52:21: Trotzdem geht es am Ende natürlich Bei beiden irgendwie um vegane Produkte, das scheint Menschen zu emotionalisieren.
00:52:29: Und deshalb wurde da, glaube ich, sehr genau hingeschaut.
00:52:32: Auf jeden Fall ein interessantes Urteil.
00:52:34: Und ab und zu ist es ja auch mal ganz erholsam, hier eine Entscheidung zu besprechen, deren Examsrelevant nicht allzu hoch ist.
00:52:44: Wir kommen nun zum Ende unserer Sendung.
00:52:47: Wer uns eine Hörerfrage stellen möchte oder Rückmeldungen und Themenideen für unseren Podcast hat, der kann gerne eine Mail an einspruchpodcast.frz.de.
00:52:56: schicken.
00:52:57: Einspruchpodcast bitte in einem Wort.
00:53:00: Und die Hörerfrage senden Sie bitte als Sprachnachricht.
00:53:03: Auf Instagram finden Sie uns unter frz.inspruch, auf linken unter fatz.pro Einspruch.
00:53:09: Und unter frankfutterallgemeine.de.
00:53:11: slash Referendariat.
00:53:13: finden angehende Referendare dann noch alle notwendigen Infos zu einem Referendariat im Justizjahrjahr der FHZ.
00:53:20: Die Referendare können sich auch bei uns hier in der Einspruchredaktion einbringen.
00:53:23: Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen eine schöne Woche.
00:53:27: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie Einspruch treu.